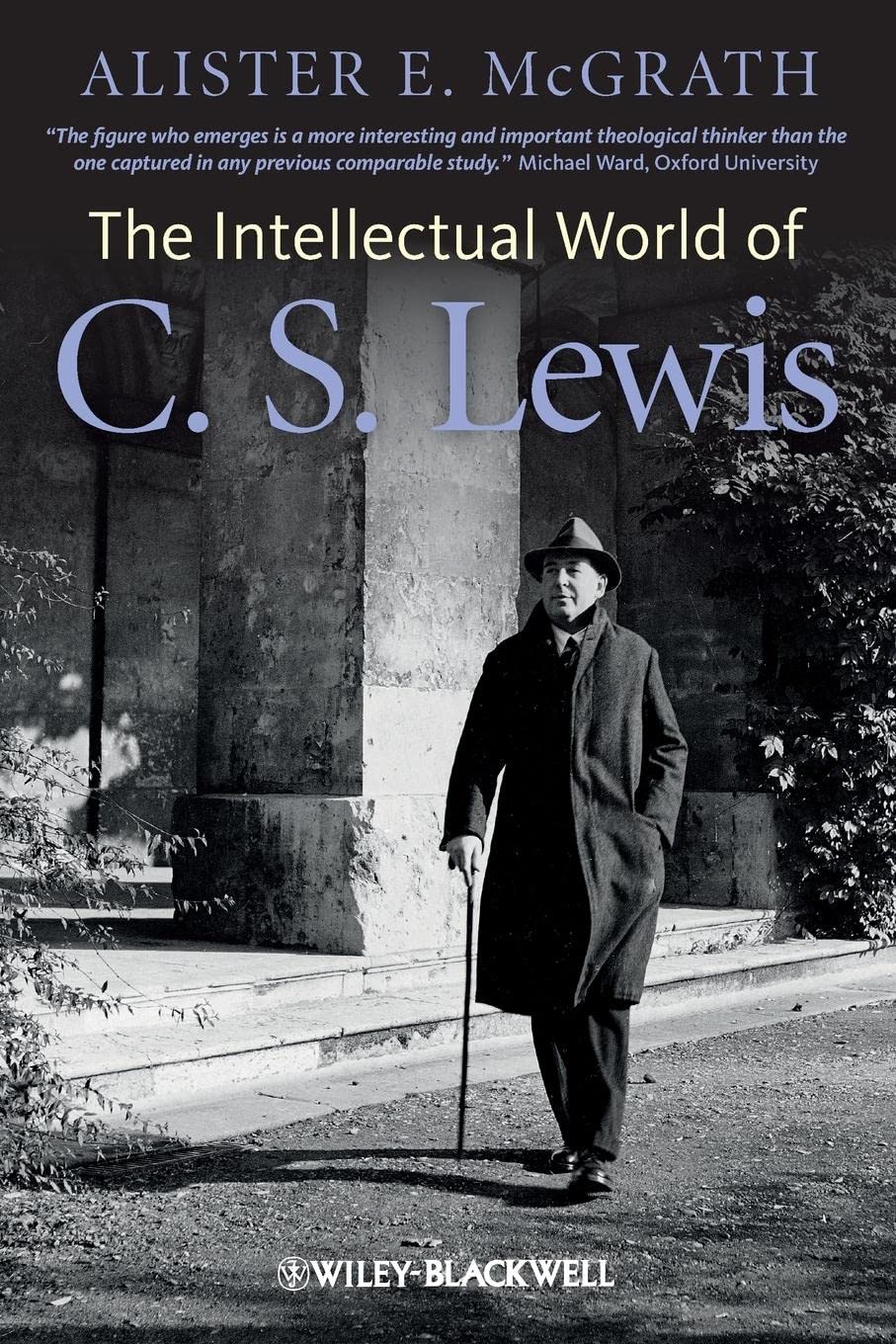
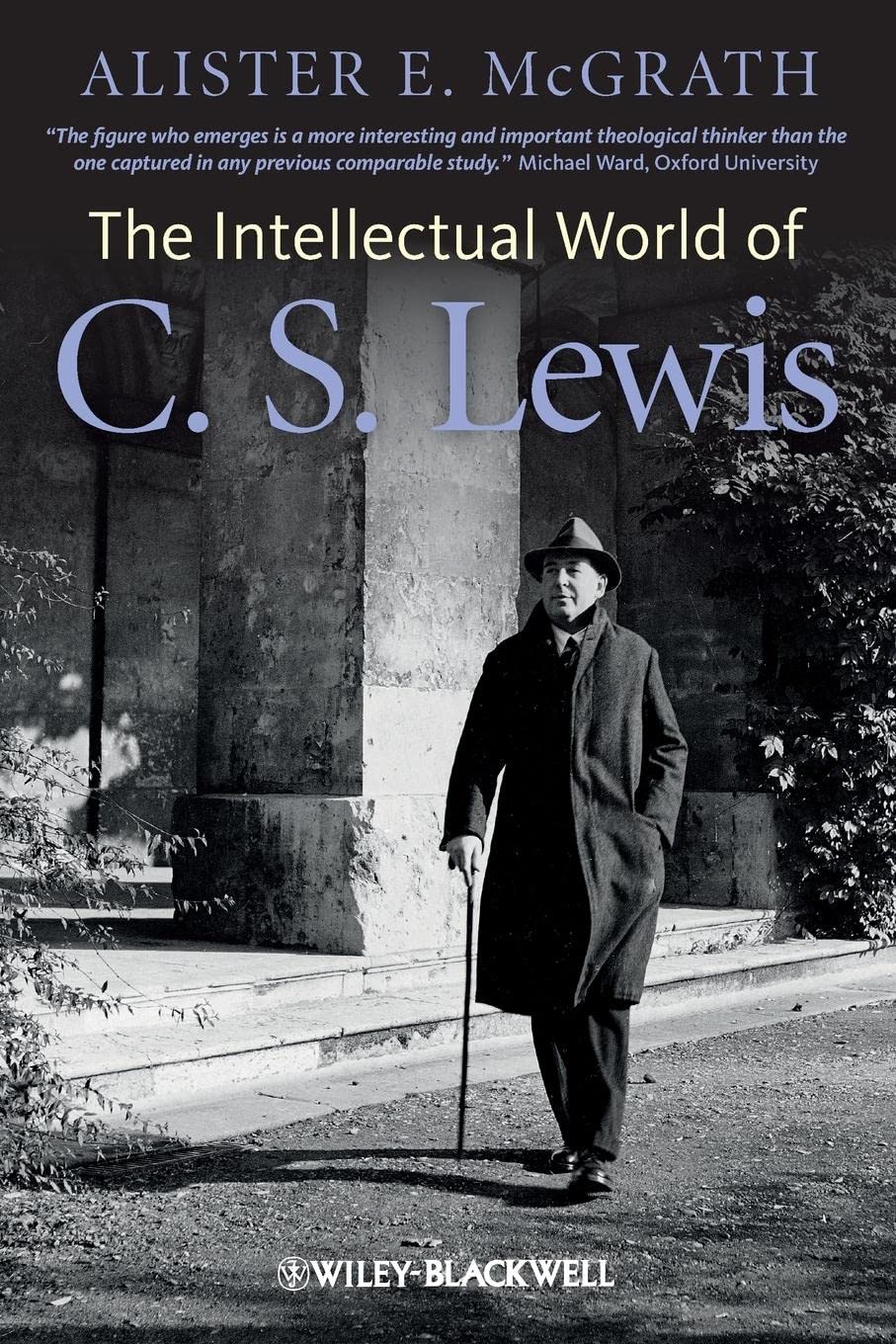
Full description not available
J**N
A valuable contribution to Lewis studies
McGrath draws on the context of Lewis's work to bring new depth of meaning to Lewis's published work. This book is a must have for Lewis scholars and a welcome and (mostly) accessible read for the merely curious.
E**L
McGrath delivers a scholarly view
McGrath is a skilled professor in the Oxford tradition, and brings his formidable skills to his C.S. Lewis research and writing. In-depth look at specific topics, not a biography.
L**G
The Non-Academic Theologian
Alister McGrath gives us an incisive précis of the mind of C.S. Lewis. It gives us an understanding of the reasons why Lewis continues to inform and inspire the current generation of Christians, often in measures more than the academic theologians. He opens to us the glory of God, rather than describes it.
W**R
Five Stars
A must read for understanding Lewis's view of "myth".
S**D
A new favorite writer
I have collected several books by Alister McGrath simply due to the subject matter. This book, along with his biography of C.S. Lewis, are absorbing reads. I cannot tell whether I enjoyed these books so much because of the subject matter or because of the writing style, or both. Alister McGrath demonstrates an amazing grasp of his subject, and a great deal more that he is able to bring to his writing. I plan to read these two works again and other works of his already in my library. He is a gold mine.
G**M
Interesting Spin-Off to McGrath's Biography of Lewis
This is a very different book from McGrath's recent biography of Lewis (C. S. Lewis: A Life). It is a collection of scholarly essays on various aspects of Lewis's thought and life. Among the topics addressed are Lewis's views on myth, his so-called argument from desire, his apologetical method, his intellectual outlook in the 1920s (prior to his conversion), his Anglicanism, and whether he is properly regarded as a "theologian." Despite its somewhat misleading title, it is not a systematic attempt to reveal "the intellectual world" of Lewis. It is a loose and not-very-unified collection of "takes" on various aspects of Lewis's personality and thought that spun off from McGrath's research on Lewis's life, and is intended mostly for Lewis scholars and aficionados.It is, nevertheless, interesting and significant. It is also bound to be controversial. McGrath argues, for example, that Lewis never intended the so-called "argument from desire" (roughly: all innate desires have a possible fulfillment; our desire for perfect and unending happiness is innate, so there must be a heaven where such a desire can be fulfilled) to be construed as an "argument" at all. To the extent that it is an argument it is an "abductive," suppositional argument of the form: We have desires that can't be satisfied in this world; if Christianity is true, we would expect to have such desires; so, there is some reason to think that Christianity is true. Such a reading is attractive to those (like McGrath) who think that Lewis's "argument," if construed as a deductive "proof," is clearly faulty. It is thus a charitable way of reading Lewis. Whether it is an accurate reading is another matter.Another controversial view defended by McGrath is that Lewis wasn't a "rational" apologist, as most Lewis fans think. Rather, Lewis anticipated a recent approach in Christian apologetics that focuses on appealing to desires, rather than "proofs" or intellectual reasons, and seeks to show how the "big picture" of Christianity makes sense because it explains better than any alternative worldview the totality of human experience. Again, readers will have to make up their own minds whether McGrath is correct in this reading of Lewis. Some may think it reflects McGrath's preferred apologetical approach more than it does Lewis's.As McGrath's endnotes make clear, this book is the fruit of wide reading and deep scholarship. He does nod in places. For instance, there is no discussion of the "Great War" between Lewis and Barfield in his chapter on Lewis's philosophical views in the 1920s. He gives no evidence of having read Lewis's lengthy unpublished "Summa," where Lewis defends a kind of Bradleyan objective idealism and an idealist/Kantian ethic at great length against Barfield's anthroposophy. (McGrath mistakenly describes Barfield as a "theosophist" (152)). For a fuller and more accurate account of Lewis's philosophical development in the 1920s, readers should consult Adam Barkman's fine book, C. S. Lewis and Philosophy As a Way of Life.
T**R
A Deeper Look into the Thought of C.S. Lewis
Alister McGrath's biography of C.S. Lewis was an incredible exploration of one of the greatest minds in the history of Christian thought. I've always enjoyed reading Lewis because of the way he explains concepts in a way that is refreshing and inspiring. I found McGrath to have that kind of way with words in his exploration of Lewis' life. He takes the exploration a step further in a new companion book to the Lewis biography, THE INTELLECTUAL WORLD OF C.S. LEWIS.THE INTELLECTUAL WORLD OF C.S. LEWIS is a collection of essays that take a deeper look into some of the ideas in Lewis' writings and the intellectual landscape that influenced much of his thinking. McGrath looks at Lewis' own autobiography and convincingly shows that Lewis' own chronology of his conversion was incorrectly remembered. He looks at the philosophical landscape at Oxford and its impact on Lewis. We're shown the role of the concept of myth in Lewis' acceptance of Christianity. McGrath looks also at Lewis' apoligetic method, his argument from desire, and his role as a theologian.While McGrath's biography of Lewis was an illuminating exploration of what shaped the man who would become one of the most quoted men of all time, THE INTELLECTUAL WORLD OF C.S. LEWIS takes us on an even deeper journey into the development of Lewis' thought over time. It's clear that McGrath drew from a vast amount of research, and this book takes the reader into some territory that will undoubtedly leave them better equipped to engage in intellectual discussion concerning the things that captured Lewis' above all else.Review copy provided by Wiley-Blackwell
J**M
Excellent
I'd recommend this to anyone studying Lewis or for the Lewis fan who wants to move beyond a basic appreciation of his work to a more complete understanding of him. Great stuff
H**L
Die emotional-imaginative Dimension des Lebens geht Hand in Hand mit der rationalen.
Ist zu C. S. Lewis nicht schon alles gesagt worden?Bei einer Recherche in der Zentralbibliothek Zürich listete mir die Suchmaschine über 100 Titel Sekundärliteratur zum britischen Literaturwissenschaftler auf. Wer die zum 50. Todestag von Lewis erschienene Biografie von McGrath gelesen hat, der kommt zum Schluss: Nein, es fehlte diese Art die Gesamtdarstellung, die ohne hagiografische Übertreibungen auskommt und sich doch mit Wertschätzung und Verständnis - McGrath war 25 Jahre lang Dozent in Oxford, erlebte wie Lewis eine Wende vom Atheisten zum Theisten und ist ebenfalls Anglikaner - Person und Werk widmet. McGrath schildert, wie er während seines Zweitstudiums in Theologie in Methodologie und Wissenschaftsverständnis der Theologie geschult wurde. Gerade diese Zunft sah Lewis als Abweichler, der sich in die Weite der populärwissenschaftlichen Schrifstellerei verirrt hatte. Lewis war nie Teil seiner offiziellen Curriculas. Trotzdem gelangte McGrath aufgrund seiner persönlichen Lektüre zur Überzeugung, dass Lewis gelesen werden muss.Ergänzung zur BiografieDas Buch ist als „Auskoppelung“ und Ergänzung zur Biografie zu verstehen. In acht Aufsätzen setzt sich der britische Gelehrte mit bisher unterbeleuchteten Aspekten von Lewis‘ Werk auseinander. Lewis steht in westlicher Denktradition und vereinigt gründliche theologische Reflexion mit einer einzigartigen literarischen Imagination (1). Ein kurzer Durchgang lohnt sich:Ein kurzer DurchgangIm ersten Aufsatz setzt sich McGrath kritisch mit der autobiografischen Schilderung „Überrascht von Freude“ auseinander. Das Werk erschien 1955, zeichnet aber die Erinnerung bis zur Bekehrung 1931 dar. Lewis hatte es nicht mit Zahlen und auch nicht mit Jahreszahlen. Das zeigte sich z. B. darin, dass er höchstwahrscheinlich die Reihenfolge bzw. Daten seiner Bekehrung durcheinander brachte. Zudem muss das Hauptanliegen von Lewis beachtet werden: Es geht darum, den Weg bis zum Wendepunkt seines Lebens nachzuzeichnen. Damit ist eine selektive Auswahl von Erlebnissen vorgegeben. Beispiel: Dass Lewis ein überaus düsteres Bild von seinen Schulerfahrungen entwirft (innerhalb des Buches ist eine deutliche Verlangsamung des Gesprächsflusses festzustellen), ist wahrscheinlich überzeichnet.Der zweite Beitrag ist der intellektuellen Umgebung von Oxford in den 1920ern während Lewis‘ Studium gewidmet. U. a. durch den bekannten (atheistischen) Philosophen Bertrand Russell (1872-1970) setzte sich eine Strömung des neuen Realismus durch. Diese prägte Lewis zutiefst. Hauptmerkmal war die Überzeugung, dass Subjekt und Objekt der Erkenntnis voneinander getrennt werden müssen und prinzipiell unabhängig voneinander existieren. Lewis glaubte an eine externe Realität, die ihm über seine Sinne zugänglich wurde. Erst später verband er diese Erkenntnislehre mit dem Theismus.Wer ohne literaturwissenschaftlichen Hintergrund Lewis liest, mag ob seines Konzepts von „Mythos“ beunruhigt sein. Oxford war Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert die Stätte intensiver Forschung zum Konzept und Begriff "Mythos". Durch den Rationalismus hatte das Wort einen abschätzigen Beiklang bekommen. Für die Literaturwissenschaft, in dessen Tradition Lewis stand, war ein Mythos jedoch eine Geschichte, durch die Wahrheit transportiert wird. Es geht also um eine literarische Repräsentation der Wirklichkeit, durch die Sehnsucht und Sinn für das Unzugängliche geweckt wird. Trotz diesen Erklärungen bin ich von dieser Begrifflichkeit nicht überzeugt. Der Grund: Zu leicht wird der „Mythos“ von der Wirklichkeit abgelöst und in Kontrast dazu gestellt (auch wenn das gerade nicht die Intention von Lewis war).Im nächsten Beitrag wird die Metaphorik von Sonne und Licht aufgegriffen, die Lewis sehr oft verwendet. McGrath zeigt auf, dass er damit in der Tradition der Heiligen Schrift und auch der Kirchengeschichte stand. Insbesondere der Bezug zu Augustinus ist überdeutlich. Als Reformierter war ich befriedigt über die Hinweise, dass in dieser Tradition die auditiven Metaphern überwiegen (das Hören auf Gottes Wort bzw. die Predigt). Gerade in diesem Aufsatz wird die gründliche Arbeit des Autors deutlich. Die Bibliografie am Ende jedes Aufsatzes ist der Beachtung wert.Wer die Autobiografie „Überrascht von Freude“, Lewis' bekanntestes apologetisches Werk „Pardon, ich bin Christ“ oder seine Predigt „Das Gewicht der Herrlichkeit“ liest, erkennt als roten Faden das Argument der Sehnsucht. Wie muss dies eingeordnet werden? Geht es um einen Gottesbeweis? Lewis kannte Momente der Sehnsucht, die ihn überraschend überfielen und wieder weg waren, ehe er sich es versah. Ursprünglich brachte er diese Momente mit einem Ort und keineswegs mit Gott in Zusammenhang. Die Form der Beweisführung ist induktiv: Es existiert im Menschen eine Sehnsucht, die immanent nicht befriedigt werden kann und deshalb über diese Welt hinausweist. Nur Gott kann diese Sehnsucht endgültig stillen. Auch hier ist der Anklang an Augustinus (und andere Denker wie von Aquin) unübersehbar.Der sechste Artikel befasst sich mit der Apologetik von Lewis. Es ist kein kohärentes System erkennbar. Vielmehr muss auf verschiedene Stränge innerhalb der Argumente geachtet werden. McGrath führt drei solcher Hauptstränge aus: Verstand, Erfahrung und Imagination. Der Verstand sammelt und sortiert Argumente in der Wirklichkeit, ergänzt durch die imaginative, narrative Darstellung der Wahrheit. Das Christentum passt letztlich am besten in die Wirklichkeit! Die emotional-imaginative Dimension des Lebens geht Hand in Hand mit der rationalen. Sie ergänzen und bereichern sich gegenseitig. Deshalb findet Lewis wohl auch im 21. Jahrhundert solchen Anklang.McGrath beschäftigt sich auch mit der konfessionellen Identität von Lewis: Er gehörte der anglikanischen Kirche an. Doch Lewis bestand gerade darauf (so etwa in der Einleitung zu „Pardon, ich bin Christ“), dass er nicht eine Konfession vertrete, sondern das „schlichte Christentum“ („Mere Christianity“). Durch seine Zugehörigkeit zur Anglikanischen Kirche sah er sich mit dem gesamten Leib Christi verbunden; sie repräsentierte eine englische Sicht der Kirche, angepasst an die soziologischen und zeitgebundenen Besonderheiten. Der Anglikanismus war für ihn mehr Vehikel als Substanz seiner Gedanken. Lewis war – wie schon früher festgestellt – fest in der grossen westlichen Tradition christlichen Denkens eingebettet.Im letzten Aufsatz geht es um Lewis als Theologen. Dieser betonte stets, dass er sich weder in konfessionelle Eigenheiten einmische noch sich als Theologe verstehe. Er bezeichnete sich vielmehr als Amateur. Die Feindseligkeit der Gelehrtenzunft von Oxford war ihm sicher. Dass er sich für den christlichen Glauben stark machte, populärwissenschaftlich schrieb und dazu noch auf solche Resonanz in Grossbritannien und auch in den USA stiess, erschienen ihnen mehr als suspekt. McGrath führt ein alternatives Konzept anstelle des an methodologische und fachwissenschaftliche Kriterien gebundenen ein: Einführung einer neuen oder Infragestellung einer bestehenden Vorherrschaft. In dieser Hinsicht gilt Lewis als führender christlicher Gelehrter des 20. Jahrhunderts – auch wenn er nicht ins Schema eines britischen Theologen von damals passte.FazitDieses Buch stellt einen substanziell-ergänzenden Beitrag zur Lewis-Forschung dar. Wer sich für Lewis interessiert und ihn etwa in Predigten, Vorträgen und Aufsätzen öfter zitiert, sollte es lesen.
J**H
A stunning read!
This was a wonderfully balanced biography with fresh detail of Lewis's life - very insightful and with a touch of Narnia!
Trustpilot
1 month ago
1 week ago